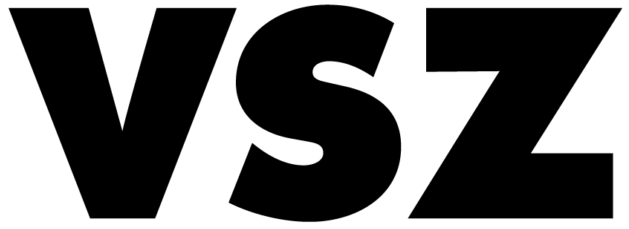Nach den gescheiterten Verhandlungen über ein globales Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll rückt ein oft übersehener Aspekt des Problems in den Fokus: Mikroplastik – eine unsichtbare, aber wachsende Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Die VSZ sagt Ihnen, was dahintersteckt.
Inhaltsverzeichnis

Bildquellen
Plastikmüll in den Ozeanen ist ein allseits bekanntes Umweltproblem, doch die wahre Bedrohung liegt oft unter dem Radar – Mikroplastik. Diese winzigen Plastikteilchen, die kleiner als 5 Millimeter sind, sind kaum sichtbar, stellen jedoch eine wachsend große Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar. Sie gelangen auf unterschiedlichste Weise in die Natur und sammeln sich sowohl in den Meeren als auch in unseren Lebensmitteln an.
Entstehung von Mikroplastik
Mikroplastik entsteht vor allem durch den Zerfall größerer Plastikmengen. UV-Strahlung, Salzwasser und Sandpartikel tragen dazu bei, dass Plastikteile im Ozean mit der Zeit in immer kleinere Partikel zerfallen. Ein weiterer bedeutender Ursprung von Mikroplastik sind alltägliche Produkte wie Kosmetika, Kleidung und Reinigungsmittel. Mikroplastik wird in Peelings, Zahnpasta und Duschgels häufig als Schleifmittel verwendet. Beim Waschen von Fleecejacken und synthetischer Kleidung gelangen zudem bis zu 2000 Mikrofasern in jedes Waschmaschinen-Abwasser.
Mikroplastik in der Nahrungskette
Obwohl Plastik selbst nicht giftig ist, wird es während seiner Herstellung mit schädlichen Chemikalien versetzt, die sich an der Oberfläche der Mikroplastikpartikel anlagern. Diese Partikel können Schadstoffe aus der Umwelt aufnehmen und in den Organismus von Tieren und Menschen befördern. Erste Labortests zeigen, dass Mikroplastik in Muscheln Entzündungen oder sogar Tumore auslösen kann. Besonders dramatisch ist die Auswirkung auf die Tierwelt: z. B. Plankton, die kleinsten Lebewesen im Meer, nehmen Mikroplastikpartikel auf, da sie diese nicht von Nahrung unterscheiden können. Diese Partikel gelangen über die Nahrungskette in größere Tiere und letztlich auch in unsere Lebensmittel. Mikroplastik wurde bereits in Fischen, Krustentieren, Honig, Milch und sogar Bier nachgewiesen.
Die Auswirkungen auf den Menschen
Wir Menschen nehmen regelmäßig Mikroplastik über die Nahrung oder Luft auf, ohne uns dessen bewusst zu sein.
Die langfristigen Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit sind noch weitgehend unerforscht, doch erste Studien deuten darauf hin, dass die Partikel Entzündungsreaktionen und hormonelle Störungen verursachen können.
Lösungen und Präventionsmaßnahmen
Zum Glück gibt es einfache Schritte, die jeder Einzelne unternehmen kann, um die Mikroplastikbelastung zu verringern. Eine der effektivsten Maßnahmen ist, Produkte mit Mikroplastik zu meiden. Der Umstieg auf Naturkosmetik ohne synthetische Mikroplastikpartikel, der Verzicht auf Plastiktüten und die Wahl von Produkten mit weniger Plastikverpackung sind nur einige Möglichkeiten, wie Verbraucher die Mikroplastikbelastung reduzieren können. Die Kosmetikindustrie reagiert zunehmend auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen und setzt auf natürliche Materialien wie Kieselsäure oder Tonerde statt Kunststoffpartikel.
Um den Plastikmüll zu bekämpfen, setzt die EU auf drei Maßnahmen: Verbieten, Reparieren und Recyceln. Einwegprodukte wie Plastik-Trinkhalme und Besteck wurden verboten und Verpackungen sollen künftig weniger überdimensioniert sein. Zudem fördert die EU das „Recht auf Reparatur“, damit Produkte länger genutzt werden. Ziel ist es, bis 2027 fast alle Verpackungen recycelbar zu machen. Doch die Umsetzung stößt auf Herausforderungen, etwa durch fehlende Infrastruktur und den Export von Müll.
Das Scheitern der Verhandlungen in Genf zeigt, dass wirksame Lösungen nicht aufgeschoben werden dürfen. Die Verbraucherschutzzentrale fordert verbindliche Regeln gegen Plastikmüll und zur Reduzierung von Plastikmüll sowie konkrete Schritte zur Eindämmung von Mikroplastik, um Umwelt und Gesundheit nachhaltig zu schützen.